
- Home
- Wissenstransfer
- Energieberatung
- Gebäudeenergieberatung
- Energieausweis erstellen lassen
- Erste Schritte zur Energieeffizienz
- ISFP
- BAFA & KfW Zuschüsse
- Heizkurve – Verluste durch falsche Einstellung
- Hydraulischer Abgleich
- Wärmepumpe im unsanierten Altbau
- Verantwortung von Hausbesitzern
- Bericht zur Wirtschaftlichkeit
- Fenster- und Türenaustausch
- Bericht zur Entwicklung der Energiepreise
- Rechtliches
- Kontakt
- Podcast
- Zertifikate
- Home
- Wissenstransfer
- Energieberatung
- Gebäudeenergieberatung
- Energieausweis erstellen lassen
- Erste Schritte zur Energieeffizienz
- ISFP
- BAFA & KfW Zuschüsse
- Heizkurve – Verluste durch falsche Einstellung
- Hydraulischer Abgleich
- Wärmepumpe im unsanierten Altbau
- Verantwortung von Hausbesitzern
- Bericht zur Wirtschaftlichkeit
- Fenster- und Türenaustausch
- Bericht zur Entwicklung der Energiepreise
- Rechtliches
- Kontakt
- Podcast
- Zertifikate

Vom Dampf zur Energieneutralität
Tannine in der Kesselwasserbehandlung – Natürliche Helfer für Korrosionsschutz und Effizienzsteigerung
In der modernen Kesselchemie erleben Tannine – pflanzliche Polyphenole – eine Renaissance.
Diese natürlichen Stoffe wirken als Sauerstofffänger, Filmbildner und Härtebildner-Inhibitoren zugleich.
Ihr Einsatz reduziert Korrosion, verhindert Ablagerungen und steigert die Energieeffizienz industrieller Dampfsysteme. [1]
Hinweis: Nur technisch gereinigte Tannine gewährleisten eine gleichbleibende Wirkung.
Unbehandelte Naturtannine können Farbstoffe und organische Nebenprodukte enthalten, die zu Verfärbungen im Dampf führen. [2]

Was sind Tannine?
Tannine gehören zur chemischen Gruppe der Polyphenole und kommen natürlich in Rinden, Blättern und Früchten vor. Aufgrund ihrer Vielzahl an Hydroxylgruppen (–OH) können sie Metallionen komplexieren und Redoxreaktionen beeinflussen. [3] Diese Fähigkeit macht sie zu effektiven, biologisch abbaubaren Korrosionsinhibitoren. [4]
Gereinigte Tannine werden heute vor allem aus Fichten-, Quebracho- oder Kastanienrinde gewonnen und chemisch so modifiziert, dass sie temperatur- und druckstabil in Dampfsystemen reagieren können. [5]
Wirkungsweise – Das Mehrfachprinzip der Tannine
Tannine wirken in drei kombinierten Mechanismen: [6]
1. Sauerstoffbindung: Tannine reduzieren gelösten Sauerstoff zu Wasser und bilden dabei stabile, nicht-reaktive Zwischenprodukte. Dieser Effekt ähnelt dem von Hydrazin oder DEHA, jedoch ohne toxische Nebenwirkungen. [7]
2. Filmbildung: Tanninmoleküle adsorbieren auf Metalloberflächen und bilden dort eine dichte, hydrophobe Schutzschicht. Sie verhindert, dass Wasser oder Sauerstoff direkten Kontakt mit dem Metall aufnehmen. [8]
3. Komplexbildung: Durch die Chelatbildung mit Calcium-, Eisen- oder Magnesiumionen verhindern Tannine die Bildung harter Beläge. [9]
Tipp: Der kombinierte Einsatz von gereinigten Tanninen mit flüchtigen Aminen kann Korrosionsschutz in Kondensatleitungen zusätzlich verstärken. [10]


Vorteile gegenüber klassischen Chemikalien
Der Einsatz von Tanninen bietet mehrere messbare Vorteile: [11]
• Keine Toxizität oder Gefahrstoffklassifizierung im Gegensatz zu Hydrazin oder Morpholin
• Biologisch abbaubar und umweltfreundlich
• Reduzierte Absalzrate durch geringeren Salzgehalt im Kesselwasser
• Bildung weicher, leicht abführbarer Schlämme statt harter Ablagerungen
• Kombinierte Wirkung aus chemischem Sauerstoffschutz und physikalischer Passivierung
Grenzen und Betriebsbedingungen
Bei Temperaturen über 250 °C kann die Molekülstruktur mancher Tanninfraktionen thermisch zersetzt werden. [12] Daher sind sie vor allem für mittlere Druckstufen bis ca. 100 bar geeignet. [13]
Eine gründliche Systemreinigung vor Erstdosierung ist essenziell, damit der Schutzfilm gleichmäßig anhaftet. [14] Hohe Eisen- oder Ölrückstände beeinträchtigen die Adsorption und Wirksamkeit.
Hinweis: Tannine ersetzen keine chemische Entgasung. Ein Rest-Sauerstoffgehalt über 20 µg/l reduziert die Wirksamkeit deutlich. [15]

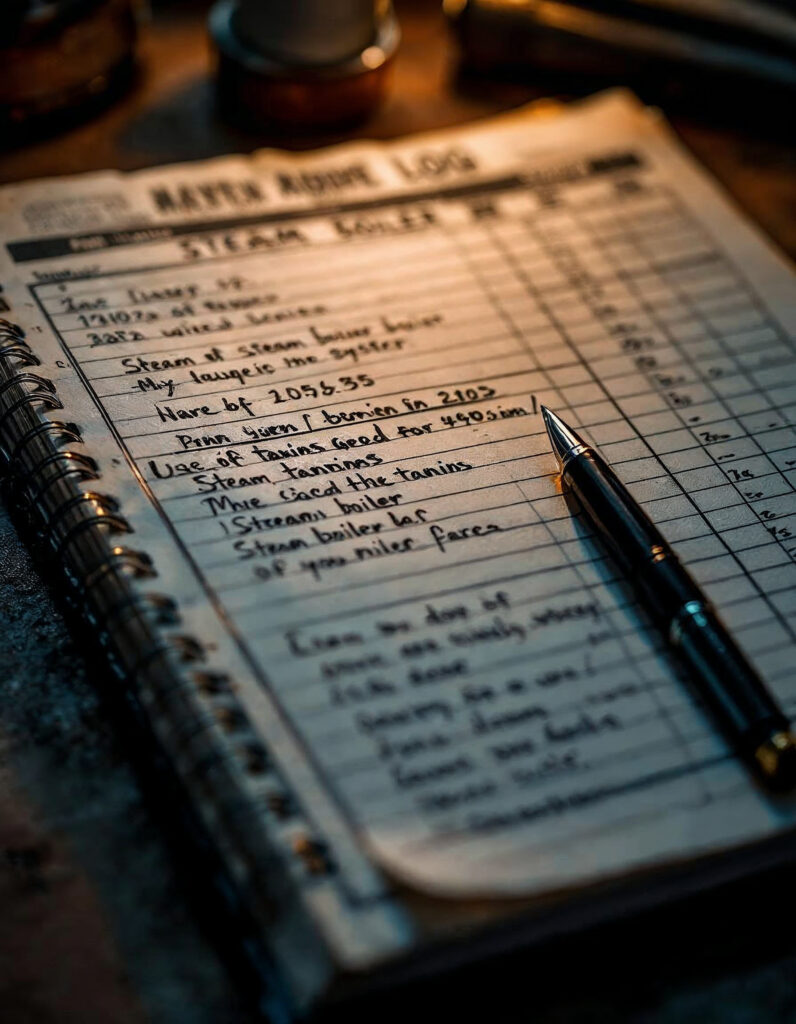
Dosierung und Kontrolle
Typische Dosierungen liegen zwischen 10–30 mg/l im Speisewasser, abhängig vom Sauerstoffeintrag. [16] Eine kontinuierliche Dosierung über Dosierpumpen gewährleistet gleichmäßige Konzentrationen. Kontrollparameter sind pH-Wert (8,5–9,5) und optische Farbe des Kesselwassers, die auf Filmstabilität hinweist. [17]
Moderne Anlagen nutzen UV-Spektroskopie oder TOC-Messungen zur Echtzeitüberwachung der Tanninkonzentration. [18]
Fazit
Gereinigte Tannine sind eine zuverlässige und umweltverträgliche Option der Kesselwasserbehandlung. Sie kombinieren chemischen Sauerstoffschutz mit mechanischer Passivierung und tragen so zur Effizienzsteigerung bei. Für mittlere Druckstufen sind sie eine technisch ausgereifte und nachhaltige Alternative zu klassischen Sauerstofffängern. [19]
Quellen & Rechtlicher Hinweis
- Feedwater – Sulphite vs. Tannin Oxygen Scavenger Treatments
- Kroff Chemical – Purified Tannin Boiler Treatment
- ScienceDirect – Tannins: Chemical and Functional Overview
- ResearchGate – Tannins as Corrosion Inhibitors in Boiler Systems
- VGB – Boiler Water and Steam Quality Guidelines (2023)
- Chemiphase – Tannin Boiler Treatment
- Association of Water Technologies – Purified Tannins in Boilers
- PubChem – Tannic Acid Substance Summary
- ScienceDirect – Adsorption Mechanisms of Tannins on Metal Surfaces
- MDPI Metals – Biogenic Corrosion Inhibitors Based on Tannins
- ResearchGate – Combined Use of Tannin and Amine Boiler Treatment
- Integra Water – Boiler Water Chemistry Control
- AWT – Oxygen Scavenger Mechanisms in Boiler Systems
- IonXchng – Comparative Efficiency of DEHA and Tannin Scavengers
- ECHA – Tannic Acid Substance Information
- WaterTech – Natural Polyphenols in Industrial Water Treatment
- ACS Industrial & Engineering Chemistry Research – Thermal Stability of Purified Tannins
- ScienceDirect – Spectroscopic Analysis of Tannin Films on Iron Surfaces
- MDPI Applied Sciences – Tannins as Green Corrosion Inhibitors
Disclaimer (Stand: 13. Oktober 2025):
Diese Inhalte dienen ausschließlich der technischen Information über den Einsatz gereinigter Tannine in Kessel- und Speisewasseranlagen.
Angaben basieren auf anerkannten Fachquellen und industriellen Anwendungen.
Sie ersetzen keine individuelle Beratung oder sicherheitstechnische Bewertung durch qualifiziertes Fachpersonal.
Phönix-ETS hält Ihre Energieanlagen verfügbar:
Von Störungsbeseitigung an Dampfkesseln bis hin zu Energieberatung für optimierte Betriebskosten